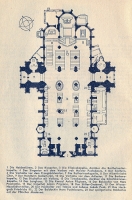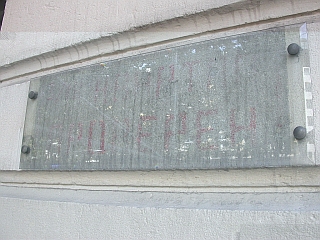Der Stephansdom und seine politische Symbolik
Seit einem halben Jahrtausend prägt der Stephansdom mit seinem
unverwechselbaren Profil die Silhouette der Stadt Wien. Wie ein Pfeil strebt sein einsamer Turm zum Himmel - der
"schönste Turmgedanke der Gotik", das von Sagen und Legenden umwobene Wahrzeichen Wiens. Das mächtige Steildach und die hochaufragende Westfassade mit den sogenannten Heidentürmen tun ein übriges, um diese Domkirche aus der großen Zahl gotischer Kathedralen herauszuheben und ihr eine Sonderstellung zu geben. Nicht nur das Äußere des Kirchenbaus, sondern auch die besondere Auffassung ihres Innenraumes macht die Stephanskirche zu einem immer wieder faszinierenden Erlebnis. Niemand geringerer als der berühmte
österreichische Architekt Adolf Loos hat dafür 1906 folgende Worte gefunden:
|
|
à Aus "Trotzdem", Brenner-Verlag, Innsbruck, 1931 (zitiert nach: Unvergängliches Wien, Europaverlag, 1964, 395).Der Bau einer Kathedrale stellte zur Zeit der späten Babenberger und frühen Habsburger ein bewusstes politisch-geistliches Programm dar. An der östlichen Peripherie des Reiches, in einer Mark ohne politisches Gewicht, wird eine romanische Riesenkirche im Stil einer kaiserlichen Pfalzkirche geplant. In der Folge wird eine französische Königskirche nachgeahmt, gleichzeitig aber der Blick auf Prag gerichtet. Die Stifter errichten eine Kathedrale in einer Stadt, die nicht einmal Bischofssitz ist - alles sehr ungewöhnliche Voraussetzungen für einen Bau dieser Ausmaße,erklärbar nur durch den unbändigen Willen zu politisch-geistlicher Selbstmanifestation. Während die ältesten Wiener Kirchen noch die Namen der Salzburger Heiligen Rupert und Peter tragen, ist die Stephanskirche bereits nach dem Titelheiligen des Passauer Domes, Stephanus, benannt. Die Absicht, politische undstaatsrechtliche Selbstständigkeit vom und im Reich zu erlangen und zu dokumentieren, ist wohl auch der wichtigste Grund dafür, dass der Wiener Stephansdom neben zahlreichen religiösen Symbolen auch viele weltliche Herrschaftszeichen enthält.
click to enlarge click to enlarge click to enlarge

Die Stephanskirche mit ihrem 137 Meter hohen gotischen Turm - der Südturm der Stephanskirche wird übrigens nur in Reiseführern und im Wiener Lied "Steffl" genannt, nicht aber im täglichen Sprachgebrauch der Wiener - ist nicht nur das Wahrzeichen der österreichischen Bundeshauptstadt sondern kann mit Fug und Recht als Dom aller Österreicher gelten. Das hat vor allem der gemeinsame Wiederaufbau des in den letzten Kriegstagen in Brand geratenen Doms gezeigt. Der Brand, der den alten hölzernen Dachstuhl einäscherte und die Pummerin, die größte Glocke Österreichs, herabstürzen ließ, war nach allem, was man weiß, nicht durch militärische Aktion, sondern durch von Plünderern in Geschäften um den Dom gelegtes Feuer entstanden. Alle österreichischen Bundesländer haben nach 1945 dazu beigetragen, dass dieses österreichische Nationalheiligtum, in dem sich alle Epochen und Episoden unserer nationalen Geschichte wie in keinem zweiten Bauwerk spiegeln, wieder zum geistig-religiösen Mittelpunkt Wiens wurde. Eine Tafel oberhalb des 1952 eingefügten Schlusssteines im Hauptschiff trägt folgende Inschrift:
| Die dich in dieses Gotteshaus ruft, die Glocke, spendete das Land Oberösterreich; das dir den Dom erschließt, das Tor, das Land Steiermark; der deinen Schritt trägt, den Steinboden, das Land Niederösterreich; in der du betend kniest, die Bank, das Land Vorarlberg; durch die das Himmelslicht quillt, die Fenster, das Land Tirol; die in festlicher Helle erstrahlen, die Kronleuchter, das Land Kärnten; an der du den Leib des Herrn empfängst, die Kommunionbank, das Burgenland; vor dem deine Seele sich in Andacht neigt, den Tabernakel, das Land Salzburg; das die heiligste Stätte des Landes behütet, das Dach, spendete im Verein mit vielen hilfreichen Händen die Stadt Wien. |
à
Zitiert nach
Gottfried Heindl, Die Welt in der Nuss oder Österreichs Hauptstadt, Paul Neff,
Wien, 1972, 193.
Anmerkung: Es ist an dieser Stelle weder geplant noch möglich, eine genaue Darstellung der Baugeschichte des Doms oder seiner architektonischen und künstlerischen Einzelheiten zu geben. Wir müssten dabei auf verschiedene Besonderheiten näher eingehen, wie etwa die Integration des romanischen Westteils in eine gotische Hallenkirche, die überdurchschnittliche Höhe des Daches oder den Umstand, dass die hohen Türme von Anfang an nicht als Teil des Westwerks geplant waren, sodass der vollendete Südturm an der Kirchenmitte zu stehen kam, etc. etc. Im Rahmen dieses Textes kommt es uns vielmehr auf die Symbolbedeutung des Gesamtbauwerks und einzelner Details an.
o Der Dom wurde bereits in seiner romanischen Bauperiode, 1147, dem Heiligen Stephanus, dem 31 n.Chr. gesteinigten Erzmärtyrer, geweiht. Seine Längsachse richtet sich genau nach jenem Punkt am Horizont, an welchem am 26. Dezember, dem Tag des Namenspatrons der Kirche, die Sonne aufgeht, wie dies bei Kathedralen in der Regel vorgesehen war.
o Einiges aus der Zahlensymbolik: der Dom ist 111 Fuß breit, 333 Fuß lang, der Südturm ist 444 Fuß hoch. 7x7x7 = 343 Stufen führen zur Türmerstube. Der Unterbau des Südturms wird durch zwölf Filialentürmchen abgeschlossen. Die Langhausfenster (Ort der Laien) haben je vier, die Chorfenster (Ort der Priester) je drei Teile.
o Der Tradition nach legte Herzog Rudolf IV. am 7. April 1359 selbst den Grundstein für den neuen Dombau zu Wien. Durch seine Verwurzelung im mittelalterlichen Denken Zentraleuropas und durch die spezifischen Ambitionen seines Stifters, der die Stephanskirche als "Capella regia Austriae", als Königskirche Österreichs, konzipiert hatte - ist der Dom von Symbolen geradezu durchwoben. Selbst in der Neuzeit - man denke nur an die zwei Türkenbelagerungen und die zwei Weltkriege, deren letzter beinahe die vollständige Zerstörung des Gotteshauses bedeutet hätte - wurden immer wieder Akte von höchster Symbolbedeutung für unser Land an diesem Ort vollzogen. Lassen wir eine Reihe solcher Akte vor unserem geistigen Auge Revue passieren:
o Vor dem Riesentor des Stephansdoms nahm die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien am 30. November 1916 nach 68-jähriger Regentschaft Abschied von Kaiser Franz Joseph I., dessen Leichnam danach in der Kapuzinergruft beigesetzt wurde. Schon seit 1887 befindet sich ein Standbild des Kaisers im Ornat des ungarischen St. Stephansordens von Franz Erler an der nordwestlichen Strebe des Adlerturms.
o Einige Schritte davon entfernt, die Nordwand entlang, war am 6. Dezember 1791 Wolfgang Amadeus Mozart eingesegnet worden, bevor die sterblichen Überreste des 35- jährigen Komponisten ihre Fahrt zum einfachen Reihengrab auf dem St. Marxer Friedhof antraten. Welch eine Spannweite zwischen diesen beiden zutiefst wienerischen und österreichischen Ereignissen!
Einige in den Dombau integrierte oder mit ihm in engem Zusammenhang stehende nicht unbedingt religiöse Symbole sind die folgenden:
o In der rechten Wand des Torbogens des Riesentors ist der Teil eines römischen Grabsteines eingemauert. Die lateinischen Buchstaben lassen erkennen, dass der Stein von einem Grabmal für einen Soldaten der X. Legion stammt, die im dritten Jahrhundert gegen die Markomannen und Quaden gekämpft hatte.
 |
o Den Kolomanistein, eine in Messing gefasste Steinreliquie, ließ Rudolf IV. im Jahre 1361 in das nordseitige "Bischofstor" einmauern. Seine Umschrift lautet:
"Hic est lapis, super quem effusus est sanguis ex serratione tibiarum S,Colomanni Martyris, quem huc collocavit illustris Dominus Rudolphus IV. Dux Austriae etc. "
Unter der Statue des Kirchenstifters und seiner Gemahlin (Originale !) sollte dieser Stein durch seinen Hinweis auf den ursprünglichen Landespatron Niederösterreichs, Koloman, die ehrgeizigen politischen Pläne der österreichischen Herrscher spirituell untermauern.
Der Kolomanistein im BischofstorIm linken Gewände
des Bischofs- oder Frauentores findet sich der durch |
o Im Vorbau des leider geschlossenen Bischofstores findet sich ein Stein mit einer geheimnisvollen Inschrift. Rudolf IV. hat sich einer eigenen Geheimschrift nach der Art von Steinmetzzeichen bedient, um seine Botschaften vor fremder Neugier zu schützen.

Die Inschrift wurde im 18.
Jahrhundert entziffert und lautet:
"Hic
est sepultus nobili stirpe dux Rudolphus fundator".
Erst durch diesen Text
erhielt Rudolf IV. den Beinamen "der Stifter"!
o Die großen, feierlich-einfachen Wappen an der Sohlbank der südlichen Turmseite (Steiermark, Niederösterreich, Österreichischer Bindenschild, Oberösterreich) stammen aus der Periode 1386-1395.
 |
o Es ist jedoch nicht voll geklärt, ob die Herzogsgestalt im Bischofstor, deren Gürtelschnalle sehr prominent den Bindenschild trägt, Rudolf IV., der Stifter (1358-65, ihm gegenüber seine Gemahlin Katharina von Luxemburg, mit Bindenschilden als Mantelspangen) ist, wie dies
Alois Kieslinger meint, oder sein Bruder und Nachfolger Albrecht III. (1365-95, mit Gemahlin Elisabeth von Luxemburg, der Schwester Katharinas), wie dies von anderen angenommen wird. Durch die Ähnlichkeit der von Wappenträgern gehaltenen Wappen (Österreich-Pfirt bzw. Böhmen-Schlesien in beiden Fällen) ist das offenbar schwierig zu unterscheiden. Für die These Kieslingers spricht, dass die entscheidenden Bauimpulse von Rudolf IV. kamen (er war 1359 der Initiator des gotischen Längsschiffs und des Südturms). Die beiden korrespondierenden Skulpturen im südseitigen Singertor, dessen Innenseite zur Zeit nicht zugänglich ist, werden allgemein als die Statuen Rudolfs IV. und Katharinas bezeichnet, wobei der Bindenschild jedoch prominent nur an den Mantelspangen der Herzogin zu sehen ist.
In jedem Falle ergab sich folgende Symbolik: wenn die Männer den Dom durch das Südtor betraten, wurden sie durch die zur Rechten stehende Gestalt des Stifters und Landesfürsten begrüßt, während die Frauen am Nordtor von einer freundlichen "Landesmutter" willkommen geheißen wurden.
o Das Porträt des Stifters - Rudolf als "Archidux" mit Bügelkrone (39 x 22 cm, Tempera auf ungrundiertem, über Fichtenholz gespannten Pergament, vor 1365) - gilt als das älteste erhalten gebliebene gemalte Porträt des Abendlandes. Bis 1933 war es in der Stephanskirche selbst aufbewahrt. Jetzt ist es zusammen mit dem Grabtuch des Domgründers (mit vergoldeten Silberfäden ornamentierter persischer Seidenbrokat, 14. Jh.) in überauseindrucksvoller Weise im Diözesanmuseum zu sehen.

o Das noch zu Lebzeiten angefertigte Kenotaph für den mit nur
26 Jahren am 27. 7. 1365 bei einem Turnier in Mailand verstorbenen Rudolf IV. zeigt den Stifter des gotischen Stephansdoms an der Seite seiner Gemahlin Katharina in festlichen Gewändern. Beider Häupter liegen auf weichen Kissen, das Paar scheint nur zu ruhen, die Augen sind geöffnet, der Blick ist ins unfassbar Weite gerichtet - im Erheben dem Osten, dem Licht zugewendet. Am Fußende wachen zwei Löwen als Sinnbild der Auferstehung. Die Absicht des Monuments ist es, nicht Tote darzustellen, sondern die Nachwelt durch einen lebendigen Ausdruck anzusprechen. Leider lässt die gegenwärtige Aufstellung des Kenotaphs keinen Augenkontakt zu - ähnlich wie auch die Figur Friedrichs III. für den Besucher praktisch unsichtbar bleibt (siehe unten).
Das Grabdenkmal Rudolfs IV. stand ursprünglich direkt über der Fürstengruft unter der Mitte des Albertinischen Chores, in der der Herzog in einem Kupfersarkophag bestattet wurde. Am 7. April 1933 wurde dieser geöffnet und das oben erwähnte Leichentuch entnommen. Der Sarg neben Rudolfs Sarkophag ist höchstwahrscheinlich nicht die letzte Ruhestätte seiner Gemahlin Katharina, die ihn um drei Jahrzehnte überlebte und erst 1395, 53-jährig, als Gattin des Markgrafen Otto von Brandenburg verstarb.
à
Rudolf Bachleitner/Peter Kodera, Der Wiener Dom, Dom-Verlag, Wien, 1966, 36 f.
à
Rupert Feuchtmüller/Franz Hubmann, Der unbekannte Dom, Herder, Wien, 1984, passim
o Friedrich III. (1415-1493) war der Großneffe Rudolfs IV. Trotz namhafter Gebietsverluste realisierte der wegen seines Phlegmas als "Schlafmütze des Reiches" titulierte Herrscher viele der hochfliegenden Pläne des Stifters. Unter Kaiser Friedrich III. wurde St. Stephan 1469 zur Domkirche erhoben. Dem sparsamen Herrscher sagt man nach, er habe bei der Errichtung des nie vollendeten Nordturms verfügt, den sehr sauer geratenen und deshalb unverkäuflichen Jahrgang 1450 des Wiener Weins zum Anrühren des Mörtels zu verwenden, was sich positiv auf die Haltbarkeit des Fundaments ausgewirkt haben soll. (Für die Einstellung des Weiterbaus am "Adlerturm" im Jahre 1511 werden mehrere Gründe angeführt: die Türkengefahr, die aufkeimende Reformation, der neue Baustil der Renaissance und - das wahrscheinlichste Motiv - Geldmangel.
| Der leider zu wenig bekannte Wiener Maler Kurt Regschek (geb. 1923), der den Stephansdom dreizehn mal nach Art der Wiener Phantastischen Surrealisten liebevoll gemalt hat, behauptet allerdings, bewusst oder unterbewusst sei die gedrungene Gestalt des Adlerturms als "weibliche" Pendant zum "männlichen" Südturm konzipiert worden. Regschek vertritt im Übrigen die These, das Vorbild für die zwei Türme, die den meisten gotischen Kathedralen angegliedert sind, seien die beiden ca. 16 m hohen Bronzesäulen (Jachin und Boas) gewesen, die König Salomons Baumeister Hiram neben die Vorhalle des Tempels stellte (1 Könige 7:15 und 2. Chronik 2 f). Um einem religiösen Richtungsstreit im Lande die Spitze zu nehmen, habe der weise König Salomo einen ausländischen Architekten, eben jenen Hiram aus der nördlich von Israel gelegenen phönikischen Kolonie Tyrus, mit dem Tempelbau beauftragt (vielleicht gab es schon damals Eifersüchteleien zwischen heimischen Architekten oder war es einfach eine fachliche Entscheidung - Hiram war ja ein ausgewiesener Fachmann und Sohn eines bekannten phönikischen Bronzeschmieds ?) |
Kurt
Regschek - St. Stephan vulkanisch (1993)
click to enlarge
àElisabeth
Jaindl, Der Stephansdom im alten Wien, Kellner-Verlag, Korneuburg, o.J
An Friedrich III. erinnert vor allem sein Grabmonument. Das freistehende Hochgrab im Apostelchor des Doms geht in seiner erhabenen Monumentalität weit über den eigentlichen Zweck einer Begräbnisstätte hinaus: politisch ist es letzter Ausdruck der wahrhaft übernationalen römisch-christlichen Reichsidee, künstlerisch kann es bereits als spätgotischer Vorbote einer barocken Gedankenwelt gelten. Das Grabmal wurde vom größten Bildhauer seiner Zeit, dem Niederländer Niklaus Gerhaert van Leyden, aus rot-weiß geädertem Untersberger Marmor geschaffen. Das vielgestaltige ikonographische Programm des Monuments umfasst insgesamt 240 Statuen. 1513 wurde der in Linz verstorbene Friedrich III. in diesem letzten großen mittelalterlichen Kunstwerk beigesetzt. Wie die meisten Gegenstände aus seinem Besitz trägt es als letzten Gruß des Kaisers an die Nachwelt das geheimnisvolle Motto AEIOU.
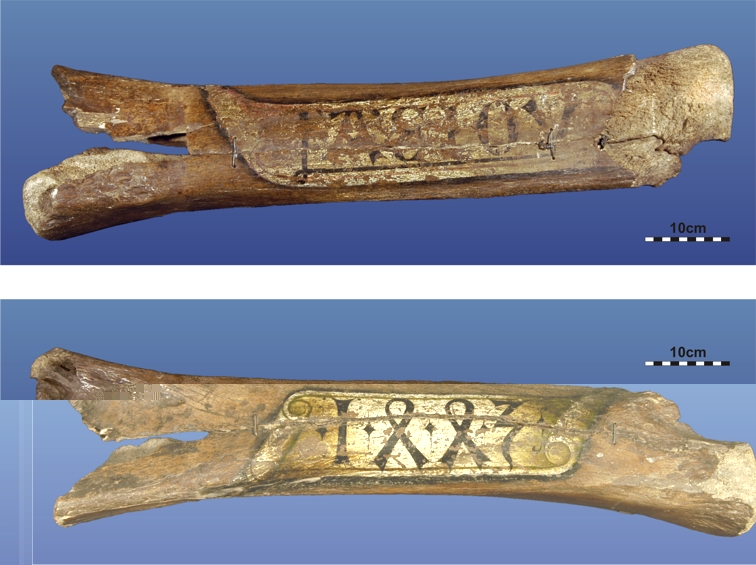 |
o Zu Friedrich III. Kuriositätensammlung zählte auch der rund 8.000 Jahre alte rechte Schenkelknochen des "Mammuts vom Stephansplatz". Nach diesem einem sagenhaften Riesen zugeschriebenen Knochen soll das "Riesentor" benannt worden sein.
|
Es handelt sich in Wirklichkeit um den Oberschenkelknochen eines Mammuts, der
wahrscheinlich bei der Grundaushebung für den heute
sagenumwobenen Nordturm des Stephansdoms im Jahre 1443 gefunden wurde und sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Sammlungen des geologischen Institutes (heute: Institut für
Geowissenschaften) der Universität Wien befindet. Er
zeigt auf der Vorder- und Rückseite je eine aufgemalte
Schriftrolle: eine mit der Jahreszahl 1443, die andere mit dem Wahlspruch von Kaiser Friedrich III. „A.
E. I. 0. U." . Dieser Knochen hing viele Jahrzehnte lang im Bereich des Riesentores von St. Stephan; dort dürften
sich mehrere solcher Reste befunden haben. Es gibt übrigens
eine ganze Reihe von Berichten über Riesenknochen, die
im 18. Jahrhundert an den Wänden von Kirchen und Schlössern
aufgehängt waren. So mancher dieser frühen
Funde von Riesenknochen wurde allerdings oft auch als vermeintlicher Rest von Einhörnern
angesehen und landete als kostbare Medizin in Apotheken, wo er für
teures Geld verkauft wurde. Aus Wien gibt es noch weitere Hinweise auf Riesenfunde: 1723 wurden auf dem Thurygrund (heute: 9. Bezirk) Reste eines „Riesen" gefunden. Sie wurden als Backenzähne eines eiszeitlichen Fellnashorns identifiziert. Leider sind die Originalfunde verschollen. Auf eine weitere Erwähnung von Riesenfunden aus Wien stößt man in der „Wienerischen Chronika" von Wolfgang Lazius aus dem Jahre 1546 (deutsche Übersetzung: 1619). Er berichtet, dass im Boden Wiens die Gebeine der in der Bibel genannten Riesen Gog und Magog gefunden worden seien. Näheres ist darüber leider nicht bekannt. Aus dem Katalog des Wien-Museums "Wiener Sagen und ihre Zeichen" |
Nach anderer, glaubhafterer Lesart kommt das Wort "Riesentor" aus dem Mittelhochdeutschen: das Westportal weist nämlich in die Richtung, in welcher die Sonne >ze rise< geht (= untergeht).Eine dritte Theorie sagt, das Wort "Riesentor" stamme von mhd. >risan< = fallen, weil es durch ein "Risgater" (Fallgitter) gegen den Stephans-Freythof hin abgeschlossen werden konnte. Schließlich wird noch die These vertreten, das althochdeutsche Wort >risen< (hineinziehen) sei die etymologische Wurzel für den Begriff "Riesentor". Es ist nicht auszuschließen, dass die besondere Form tief abgestufter gotischer Trichterportale mit Mandorla im Tympanon unterschwellig sexuelle Bedeutung besitzen - als Gegenstücke zu den phallischen Turmsymbolen
o Die Kreuzkapelle links vom Haupteingang ist zugleich das Grabmal des Prinzen Eugen von Savoyen (1663-1736), des erfolgreichsten Feldherrn Österreichs und großen Mäzens der Barockzeit. Er lebt nicht nur im bekannten Volkslied "Prinz Eugen, der edle Ritter, wollt' dem Kaiser wied'rum kriegen Stadt und Festung Belgerad ...", sondern vor allem durch sein Sommerschloss Belvedere und seine Bücher- und Kartensammlungin der Nationalbibliothek weiter. In der Kapelle hängt ein großes hölzernes Kruzifix. Das Kinn des Gekreuzigten ziert anstelle eines geschnitzten Bartes ein schwarzer Bart aus echten Haaren. Die Legende sagt, der Bart sei immer wieder nachgewachsen, nachdem ihn fürsorgende Jungfrauen alljährlich am Karfreitag gestutzt hätten.
 |
o Die Katharinenkapelle, deren Eingang unterhalb des Südturms liegt, ist ein architektonisches Juwel (14./15. Jh.). Der aus einem Achteck entwickelte Zentralraum besitzt einen kleinen Chor. Frei schwebende Rippen des Sterngewölbes vereinigen sich zu einem hängenden Zapfen, dessen Schlussstein die Halbfigur der hl. Katharina von Alexandrien, Patronin der Philosophen, mit Schwert und Rad zeigt.
An der Westseite dieser Kapelle hing einige Zeit ein 4 m hohes Bild des in den USA sehr bekannten katholischen Malers und Bildhauers F.C. Shrady (1907-1990), das den Titel "The Last Nail" trägt. Es wurde 1947 von Katholiken der amerikanischen Besatzungsmacht gestiftet. Der letzte Nagel vor der Kreuzabnahme soll den letzten Leidensnagel des österreichischen Volkes, die zehnjährige Besetzung durch die alliierten Siegermächte, symbolisieren. In den Jahrzehnten nach dem Krieg hing das Bild an verschiedenen Stellen der Stephanskirche. Zuletzt befand es sich in totaler Finsternis am staubigen Dachboden des Domes, wo es bei den samstäglichen Abend-Führungen besichtigt werden konnte, aber nicht ausdrücklich gezeigt wurde. Wie es scheint, ein typisch österreichisches Schicksal. Seit das Gemälde im Mai 2005 in eine kleine zeitgeschichtliche Ausstellung integriert wurde, gibt es Bestrebungen, das Bild an einem prominenterem Ort auszustellen. Unten die Beschreibung des Bildes bei seiner Übergabe an die Domkirche.
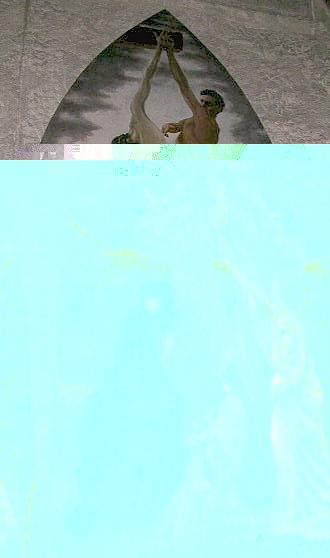 |
|
Kathpress
Nr.500
Wien, am 23.09.1947 Am
Nachmittag des 22. September 1947 fand im Konsistorialsaal des Erzbischöflichen Palais
eine Feier statt, bei der das Gemälde des amerikanischen Malers
Frederick C. Shrady an den Dom übergeben wurde. Der Feier wohnten
bei: Kardinal Dr. Innitzer, Erzbischof Dr. Kamprath mit den
Mitgliedern des Domkapitels, Bürgermeister Körner, in Vertretung des
Bundeskanzlers Dr. Figl Sektionschef Dr. Chaloupka, und zahlreiche Persönlichkeiten
der Politik, der Wissenschaft und Kunst. |
o Vor dem Eingang in die Katharinenkapelle erinnert eine genau unter der Turmspitze des Südturms in den Boden eingelassene Gedenktafel an den vornehmsten von sieben Vermessungspunkten der Grundsteuerbemessung von 1817, mit welchem die gesamte
Donaumonarchie mit Ausnahme der Länder der Stephanskrone katastriert wurde.
Beachte: Die Bestimmung der geographischen Länge erfolgt hier nicht nach
dem 1884 eingeführten Nullmeridian von Greenwich, sondern "nach
Ferro". Dieses Maß wurde im Jahr 150 n. Chr. von Claudius Ptolemaeus
an die westlichste Grenze der bekannten Welt, an die Isla del Meridiano (El Hierro oder Ferro), die westlichste Insel der Hesperiden (heute Kanarische Inseln)
angelegt. Im April 1634 wurde die Insel Ferro von einem Gelehrtenkongress aller seefahrenden Nationen
bestätigt. Ab 1738 wird in England der Meridian von Greenwich angewandt. In Deutschland wird er 1885 übernommen, in Frankreich um 1900. Österreich-Ungarn verwendet ihn bis 1918 parallel mit dem alten Ferro-Meridian.
 |
o Die unterhalb des Nordturms liegende Barbarakapelle
(1492) ist ebenfalls aus dem Oktogon gestaltet. Ihr Doppelsterngewölbe läuft jedoch in zwei Hängezapfen aus, die Reichsadler und
Bindenschild tragen.
Unter dem Kruzifix wurde eine Kapsel mit Asche aus den Krematorien des Konzentrationslagers Auschwitz
eingelassen. Sie war 1983 von Franciszek Kardinal Macharski im Beisein von Papst Johannes Paul II. an Franz Kardinal König übergeben worden.
 |
o Die Pummerin ist die größte Glocke Österreichs. Ursprünglich 1711 in der Leopoldstadt aus dem Metall türkischer Kanonen hergestellt, läutete die 17.000 kg schwere alte Pummerin von ihrem hölzernen Gestühl im Südturm aus zum ersten Mal am 26. Jänner 1712, als Karl VI. nach der Kaiserkrönung in Wien einzog. Die alte Glocke zeigte den hl. Josef mit den Wappen von Böhmen und Ungarn, die Jungfrau Maria mit dem kaiserlichen Wappen und den hl. Leopold mit dem österreichischen Wappen. Zum letzen Mal vor ihrem traurigen Ende ertönte ihre zwischen dem großen Bund dem großen H angesiedelte Stimme zu Ostern 1937. Die mächtige Glocke zerschellte beim Brand des Doms am 12. April 1945, nachdem sie 50 m in die Tiefe gestürzt war.
|
|
 |
In einem Pfarrführer aus dem Jahre 1958 berichtet der bekannte Wiener Publizist Jörg Mauthe (1924-1986) über die tatsächlichen Vorgänge beim Brand des Doms:
|
Als der Dom in Flammen stand . . . Sonntag, 8.
April 1945: Montag, 9.
April 1945: Dienstag,
10. April 1945: Mittwoch,
11. April 1945: Donnerstag,
12. April 1945: Freitag,
13. April 1945: |
In der Glockengießerei St. Florian am 5. November 1951 nach einem misslungenen ersten Versuch auf Kosten des Bundeslandes Oberösterreich aus dem alten Metall wieder gegossen, kehrte die neue Pummerin am 26. April 1952 in einem ergreifenden Triumphzug nach Wien heim. So wie die alte "Josephinische Glocke" einige Monate nach dem Tod Josephs I. mit ihrem Einzug am 29. Oktober 1711 das Ende der Türkenkriege und Ungarnaufstände signalisierte, galt die neue Pummerin sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als ein Symbol für die glückliche Wiedergeburt Österreichs aus Trümmern und Not. Die neue Pummerin hat einen Durchmesser von 314 cm und ist mit Krone 294 cm hoch. Mit ihren 20.130 kg ist sie nach der "Deutschen Glocke" des Kölner Doms (23.500 kg) die zweitgrößte Kirchenglocke der Welt. Sie trägt sechs Türkenköpfe auf den Armen der Henkelkrone, drei Bildreliefs (Madonna, Türkenbelagerung 1683 und Dombrand 1945) und eine Weiheinschrift, deren lateinischer Text in deutscher Übersetzung lautet:
o "Wiederhergestellt unter Theodor Kardinal Innitzer über Betreiben von Heinrich Gleißner durch Werkmeister Karl Geisz; geweiht der Königin von Österreich, damit durch ihre mächtige Fürbitte Friede sei in Freiheit. 1951" o "Gegossen bin ich aus der Beute der Türken, als die ausgeblutete Stadt nach tapferer Überwindung der feindlichen Macht jubilierte. 1711." o "Geborsten bin ich in der Glut des Brandes. Ich stürzte aus dem verwüsteten Turm, als die Stadt unter Krieg und Ängsten seufzte. 1945." |
Über dieser Inschrift befindet sich eine Darstellung des Bundeswappens, darunter das oberösterreichische Landeswappen sowie die Wappen Kardinal Innitzers, des Linzer Bischofs Dr. Josef Fließer und der Glockengießerei St. Florian.
Als der Dom nach den Kriegszerstörungen am 27. April 1952 feierlich wiedereröffnet wurde (am siebenten Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung!), wurde die neue Pummerin das erste Mal angeschlagen.
Am 5. Oktober 1957 in ihre neue Glockenstube unter dem Helm des 68 m hohen Nordturms aufgezogen, erschallte ihr nunmehr auf das kleine c+4/16 gestimmtes Läuten bereits über einem freiem Österreich, zum ersten Mal am 13. Oktober 1957. Seither begleitet ihr sonorer Klang die hohen kirchlichen Feste und das ausgelassene Treiben am Silvesterabend - ganz im Sinne von Franz Karl Ginzkey, der ihr diesen Hymnus widmete:
| Sei gegrüßt uns, Heimgekehrte, Uns im Herzen lang Entbehrte, Wieder uns zum Trost verliehn! Als Vermächtnis neu gestaltet, Und von Treugefühl verwaltet, Ziehst du in dein altes Wien. Wieder wird auf starken Schwingen Deine dunkle Stimme singen, Wie sie einst den Vätern klang. Gottes Huld sei dir beschieden! Singe du das Lied vom Frieden Und dem Schöpfer Preis und Dank! |
à1945 Chronologie einer Zerstörung, Der Dom zu St. Stephan, Dom-Verlag, Wien, 2000, S. 68 f.
Über dem nördlichen Eckstein des Riesentores erinnern zwei Norm-Maße (alte Wiener Elle mit 77 cm und Klafter mit 90 cm) und darüber ein geheimnisvolles Kreismaß daran, dass hier einst ein Ort der Rechtssprechung war. Während die eisernen Längenmaße manch betrügerischem Stoffhändler zum Verhängnis wurden, stammt der Kreis von einem Eisenhaken, der zur Befestigung des geöffneten linken Flügels des mächtigen Gittertores diente (siehe Vergrößerung unten). In der Bevölkerung hielt sich freilich hartnäckig der Glaube, dass es sich bei dem Kreis um das richtige Maß für Brotlaibe handle. Grobe Verstöße gegen das Gewicht des Brotes wurden in Wien bekanntlich durch das "Bäckerschupfen" geahndet: der geizige Bäcker wurde in einem versperrten Eisenkorb einige Male in das Wasser eines Donauarmes versenkt. Links im Bild sieht man noch Einschusslöcher von den Straßenkämpfen um den Dom im April 1945.
o Soldaten der Roten Armee haben nach der Einnahme Wiens im April 1945 an der Südecke der Westwand eine zyrillische Inschrift angebracht. Sie ist nur mehr ganz undeutlich zu erkennen. Das Wort könnte auf Russisch " ПРОВЕРЕНО " oder " ПРОВЕРЕННЫЙ " heißen: auf Deutsch "überprüft". Es könnte sich darauf beziehen, dass der Dom für minenfrei erklärt wurde. Vielleicht können Fotos aus der Nachkriegszeit zur Klärung dieser Frage beitragen. Man sollte dieses zeitgeschichtliche Dokument erhalten, also eventuell restaurieren, jedenfalls aber durch Glas schützen wie die Inschrift am Haus 1., Akademiestraße-Kärntnerring (Bild rechts).
|
|
|
o Den Gedanken des tragenden Ecksteines greifen Statuen des Stifterehepaares auf, deren Originale sich heute im historischen Museum der Stadt Wien (Wien Museum) befinden: An der südlichen Eckstrebe die Statue Erzherzog Rudolfs IV.mit Erzherzogskrone und zwei Wappenträgern, am nördlichen die seiner Gemahlin Katharina, Tochter Kaiser Karls IV. Rudolf war schon als Neunjähriger der sechsjährigen Kaisertochter angetraut worden, deren Vater dem 19-jährig zur Herrschaft gelangten Habsburger zum großen Vorbild werden sollte. So ist der Stephansdom auch in Konkurrenz zum 1344 gestifteten Prager Veitsdom entstanden - wie auch die Wiener Universität (1365) der Prager Karls-Universität (1348) nacheiferte. Interessant das Wetteifern des Schwiegersohns mit dem Schwiegervater - der Stadt an der Donau mit der Stadt an der Moldau. Ein Standbild (Kopie) Kaiser Karls IV. (um 1365) befindet sich an der südwestlichen Strebe des Südturms.
o Nicht alltäglich für einen Kirchenbau sind die beiden doppelten Halbsäulen an der Westfassade des Stephansdoms, deren nördliche in einem naturgetreuen männlichen und deren südliche in einem ebensolchen weiblichen Geschlechtsorgan enden. Sie stehen in einem Spannungsverhältnis zu den Formen der beiden "Heidentürme". Ihre Funktion ist es, die Vollkommenheit des Menschen in seiner Zweigeschlechtlichkeit auszudrücken.
 |
 |
o Ebenfalls an der Westfassade, gleich rechts neben dem Riesentor, findet sich das in den uralten Stein gemeißelte Zeichen "O5". Es wurde in den letzten Monaten der NS-Herrschaft von der vorwiegend bürgerlichen Widerstandsbewegung als Kürzel für "OEsterreich" verwendet. Als eines der wenigen Widerstands-Zeichen erinnert es an jene Österreicher, die nicht mit den Wölfen heulten, sondern ihr Leben aufs Spiel setzten, um die Ehre Österreichs zu retten. Von Zeit zu Zeit wird das Zeichen liebevoll mittels weißer Kreide sichtbar gemacht - als bleibende Mahnung: zu verzeihen, aber niemals zu vergessen.
 |
o Das nach dem Brand im April 1945 völlig neu konstruierte Dach (Metall statt Lärchenholz, glasierte Ziegel - wie die aus der Gotik - aus Poštorná bei Břeclav/Lundenburg in Mähren) wurde 1950 fertiggestellt. Es zeigt eine heraldische Besonderheit: aus Gründen der Courtoisie gegenüber dem Wappen der Bundeshauptstadt Wien blickt der Adler im österreichischen Bundeswappen nicht wie üblich nach (heraldisch) rechts, sondern über seine linke Schulter zu seinem "Kollegen" nach links ("widersehend").
 |
o Von den feierlichen Glasmalereien aus der Zeit zwischen 1330 und 1350 überlebten nur 90 die Barockzeit, die sich durch die
Entfernung der das ganze Langhaus zierenden bemalten Fenster mehr Licht verschaffen wollte. Nur die Fenster des Chores wurden nach dem Krieg mit erhalten gebliebenen Originalscheiben ausgestattet. So befindet sich gegenüber dem erzbischöflichen Thron das neu arrangierte Glasgemälde mit der großen Kreuzigung:
- in der untersten Reihe der hl. Stephanus, Patron der
Kathedrale, bei seiner Steinigung,
- darüber die Wappen von Kärnten, Niederösterreich und Steiermark,
- oben Fensterarchitektur gekrönt von der Kreuzigungsszene mit Assistenzfiguren.
Die etwa 1390 entstandenen "Fürstenfenster" aus der südwestlichen Bartholomäuskapelle des Doms zählen zu den eindrucksvollsten Exponaten des
Wien Museums. Darunter befinden sich die nach Prager Vorbild in der Wiener Hofwerkstatt gestalteten "Habsburgerfenster", die - im Gegensatz zu den um 1280 entstandenen Babenberger-Fenstern im Brunnenhaus des Stiftes Heiligenkreuz - nicht dem Gedächtnis der Ahnen, sondern der Verherrlichung des regierenden Geschlechts (von Rudolf I. bis Friedrich III.) dienten. Abschließend soll noch eine Stimme zu Wort kommen, welche den Dom zu St. Stephan als ein Symbol besonderer Art zu würdigen wusste. Es sind die Worte des bekannten Wiener Kulturpublizisten
Willy Lorenz (1914 -1995):
Die Mystiker des Mittelalters hatten das "himmlische Jerusalem" als eine kristallene Stadt geschaut, mit leuchtenden Wänden aus Edelsteinen, von göttlichem Licht durchschienen. Diese Visionen, welche die Mystiker mit dürren Worten in die Sprache der Erde zu verdolmetschen suchten, wollten die gotischen Architekten mit den Mitteln der Erde vor die Augen der Menschen zaubern. Tatsächlich gelang es ihnen durch Auflösung der Wände in Glasfenster, durch Beschränkung der Steinverwendung auf das Mindestmaß eines Konstruktionsgerippes, durch Auflösung dieser Steine in filigranste Formen, eine Entmaterialisierung des Materials vorzutäuschen und den Bewohnern der Erde in den Kathedralen nicht nur ein Symbol, sondern ein sichtbares Abbild des himmlischen Jerusalem zu geben. So erwuchs innerhalb der Mauern des "irdischen Jerusalem" die Pracht des "himmlischen Jerusalem". Konzeption hatte sich der Protest der Bettelorden erhoben. Sie lehnten es ab, aus der Kirche eine eitle Schau zu machen. Für sie ist die Kirche nichts anderes als ein Haus neben anderen Häusern, eine schlichte Gebetshalle neben den Markthallen. Die Kathedrale von Wien stellt den großartigen Versuch einer Synthese zwischen beiden Formen dar: der Chor ist Bettelordengotik, das Langhaus Kathedralgothik. Die große Kraft und Kunst des Österreichers, immer wieder Synthesen zu finden, hat sich auch an diesem Bauwerk bewiesen: es gelang hier, den Stil der Könige und der Bettler, die Kunst der mächtigsten Herren und der mindesten Brüder, zu einer Einheit werden zu lassen und in der Stadt des irdischen Königs von Jerusalem (die Habsburger trugen diesen Titel) dem himmlischen Jerusalem des Königs der Könige ein Abbild von einmaligem Glanz erstehen zu lassen. |
à
Festschrift zur Wiedereröffnung des Albertinischen Chores, Verlag der Dompfarre,
Wien, 1952, 27.
Besonders empfehlenswert:
à 850 Jahre St. Stephan - Symbol und Mitte
in Wien, Katalog des Wien Museums, Wien
1997,
491 Seiten
à Reinhard H. Gruber, Die Domkirche Sankt Stephan zu Wien, 1989
à
Robert Bouchal, Reinhard H.
Gruber, Der Stephansdom, Pichler Verlag, Wien, 2005,
EUR 29,90